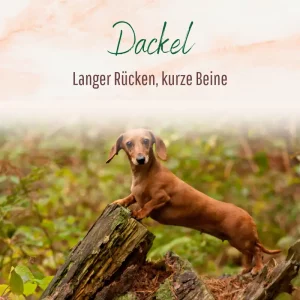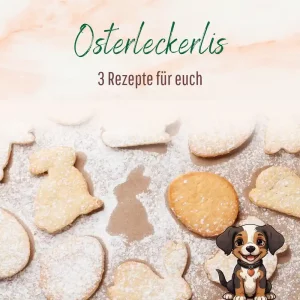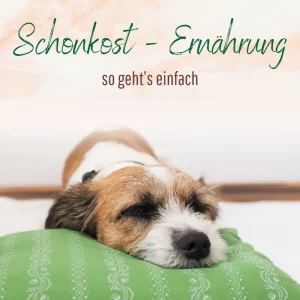Wenn Menschen bei uns an „Tierheime“ denken, haben sie meist ein Bild vor Augen: Saubere Zwinger, medizinische Versorgung, Gassigeher, Vermittlungsarbeit. Doch in vielen anderen Ländern ist ein Tierheim keine Schutzstätte, sondern eher ein Ort des letzten Überlebensversuchs, oft unter dramatischen Bedingungen.
Tierheime im Ausland, oft überfüllt und unterversorgt:
Viele Tierschutzorganisationen arbeiten mit privaten oder kommunalen Tierheimen zusammen, in denen die Realität meist so aussieht: Viel zu viele Hunde auf engem Raum. 50, 100 oder mehrere Hundert Hunde leben in Zwingern, Gruppen – oder Freigehegen, häufig ohne Rückzugsmöglichkeiten. Kaum Personal und Mittel, denn eine Hand voll Menschen (wenn überhaupt) versorgen täglich die Hunde.
Es fehlt an Futter, medizinischer Versorgung, Decken, Zuwendung, Strom und sogar warmen Wasser. Es ist eine dauerhafte Stressbelastung für die Hunde, durch Lärm, Konkurrenz, Platzmangel und mangelnden Kontakt zu Menschen. Dadurch werden viele Hunde verhaltensauffällig, ängstlich oder sogar apathisch.
Teilweise haben viele Hunde einen sehr langen bis hin zu einem lebenslangen Aufenthalt im „Tierheim“, weil sie nicht vermittelt werden oder sich „nicht eignen“. In Rumänien oder Bulgarien fristen viele ihr gesamtes Leben im Zwinger. Einige dieser Heime werden von engagierten Privatpersonen oder Tierschutzvereinen getragen, unter großen Opfern. Andere hingegen sind staatlich geführt und es werden regelmäßig minimale Kontrollen durchgeführt, aber oft ohne echtes Interesse am Tierschutz.